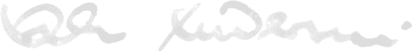»Anfang Januar 1931 verabschiedet sich in Bremerhaven Liselotte Wilke, geborene Bunnenberg, von ihren beiden kleinen Söhnen Björn und Michael und besteigt den Zug in Richtung Berlin, voller Zuversicht über ihre Zukunft. Ihre kleine Tochter Litta hatte sie schon an ihre ältere Schwester Thekla ›abgegeben‹
›So bald es geht, kommen die Kinder zu mir‹, versucht sie ihre Mutter zu beruhigen, die von dem Entschluss ihrer Tochter alles andere als entzückt ist. Aber die Vorwürfe ihrer dominierenden und als leicht exzentrisch geltenden Mutter hört Liselotte nicht mehr, als sie endlich im Zug sitzt. Sie denkt nur noch an die Zukunft, und die heißt: Theater – und wer zum Theater will, geht nach Berlin. In Berlin drehen Regisseure wie Fritz Lang, Robert Siodmak, Georg Wilhelm Pabst, Ernst Lubitsch und Billy Wilder ihre ersten Filme – und junge Mädchen träumen von ihrer großen Chance.
Liselotte hat sich bei den Freunden ihres Mannes Paul Ernst genau erkundigt, wo man in Berlin als angehende Künstlerin hingehen muss, wer für sie und ihre Karriere von Bedeutung sein könnte und wo es sich in der Millionenstadt angenehm wohnen lässt. Und während sich ihr Mann noch über das Interesse seiner jungen, unerfahrenen Frau amüsierte, schmiedete Liselotte ihre Zukunftspläne. Sie habe Kinderkriegen und Ehefrau spielen endgültig satt, niemand könne sie daran hindern, nach Berlin zu fahren, um dort beim Theater Karriere zu machen. Ambitionen hatte sie immer, ein bisschen Theater hat sie auch schon gespielt; alles andere würde sich finden.«
In der Reichshauptstadt wartet noch kein verlockendes Angebot auf die junge Frau aus Bremerhaven. Nach wenigen Tagen des Suchens erhält sie aber eine kleine Rolle in einem Film von Fritz Lang: 60 Reichsmark beträgt der erste Eigenverdienst. Mit solch kleinen Gelegenheitsverdiensten bestreitet sie in Berlin vorerst ihren Lebensunterhalt, manchmal darf sie auch im Rundfunk ein oder zwei Chansons für das gleiche Geld singen.
Kurze Zeit später wird ihr angeboten, im Tingeltangel-Theater der Kabarettistin Blandine Ebinger, Friedrich Holländers Ehefrau, vorzusingen. Sie erhält von ihr »ehrliche, beglückende Kritik«, so schreibt Liselotte ins Tagebuch. Mehr geschieht nicht.
Ab Februar 1931 ist sie ein Mitglied der Künstlertruppe des Kabaretts Ping-Pong. »Die Kritiken sind sehr gut. Wenn halt nur die Gage einigermaßen so gut wäre wie die Presse. Aber wir arbeiten ja kollektivistisch und müssen alle Unkosten für Reklame, Ausstattung usw. selbst tragen.« Auf die Frage, wovon sie denn lebe, erwidert sie lächelnd: »Vom Glücklichsein, vom Applaus, von der Liebe. Ich weiß es wirklich nicht!«
Sie nimmt an künstlerischen Angeboten, was sie erwischen kann; so spielt sie in Zürich Kabarett-Theater, fährt darauf nach Baden-Baden und kehrt nach Berlin zurück. »Da ich für die Zimmermiete nicht genügend Geld habe, wohne ich vorübergehend bei Freunden. Erst als ich im Rundfunk Chansons singen darf, gibt es Geld, und ich kann mir eine eigene Bleibe nehmen.«
Ihren unruhigen Lebenswandel der ersten Berliner Jahre als Künstlerwillige beschreibt ein Chanson sehr gut, dem sie bis vor ihrem Tode die Treue hielt:
Der Junge an der Reling singt Was geht euch denn mein Leben an!
Da hängt viel Freud und Tränen dran.
Das Ziel ist fern, die Fahrt ist weit,
das Meer ist so unendlich breit.
Wir nehmen unser Heuergeld
und fahren dafür um die Welt,
hoppla hoppla he!
Zu ihren bekannteren Freunden aus den Berliner Anfangsjahren zählen Peter und Willi Schaeffers, Lotte Lenja, Trude Hesterberg, Fritz Kortner, Billy Wilder und Curt Bry, mit dem sie seine neuen Chansons einübt.
Die Meinungen über ihre künstlerischen Fertigkeiten sind geteilt: Pressestimmen sind durchweg wohlwollend, und auch Erich Kästner, den sie telefonisch um neue Texte für sich bittet, sichert ihr zu: »Ich möchte Ihnen gerne etwas von meinen Sachen geben, denn ich bin überzeugt, dass Sie viel können und sehr gefallen.« Doch ihr Freund Willi Schaeffers sieht »keine Spur von Bühnenerfahrung«, und das Mehringsche Chanson Die kleine Internationale bringt sie im Ping-Pong derart schlecht, dass die Direktion sie nach der Premiere nicht mehr auftreten lässt.
Auch in ihrem zweiten künstlerischen Engagement, dem Kabarett Corso, ist sie anfangs nicht gut. Die Leitung verlangt daher von ihr, dass sie ihr Repertoire auf Schlager und Gefälliges umstellt, da sonst ihr Programm gekürzt wird. »Bitte,« schreibt sie trotzig in ihr Tagebuch, »dann singe ich eben ein paar belanglose Nummern; aber meinem Mehring und Tucholsky bleibe ich dennoch treu.« Das Corso trennt sich schließlich von ihr, und im Kurfürstendamm-Theater winken ihr gerade einmal 10 RM als eines der sieben Mädchen von Mahagonny in Weills und Brechts gleichnamiger Oper. Immerhin.
Sogar im Schreiben versucht sich Lieselotte: »Am 4. Januar 1932 hat sie ihr erstes Buch, eine Liebesromanze, die unveröffentlicht bleibt, endlich fertig, und nun wandert das Manuskript durch die Verlage.« Bei der Electrola verdient sie sich 15 RM für eine Mahagonny-Plattenaufnahme, und im Januar 1932 geht sie nach Zürich, wo das Kabarett Metropol sie vorerst verpflichtet hat. (Quelle: Litta Magnus Andersen (1991) S. 9–16)
[…]
1932 (19. Februar) Pressenotiz in der »Neuen Zürcher Zeitung«
Kabarett Metropol. to. Die strohblonde Liselott Wilke hat sich dem Song der Matrosen- und Hafenatmosphäre verschrieben – so glaubhaft, als wäre sie ihre Heimat. Sie lässt die hoffnungslos freche Verworfenheit des Kaschemmenmilieus von St. Pauli lebendig werden, indem sie mit der ganzen desillusionierten Lässigkeit der vom hemmungslosen Leben Entinnerlichten in dem Chanson von der Anna Jantzen (übrigens einer Reprise des letzten Programms) Phrasenenden fallen lässt: schon diese Vortragsnuance verrät Können.
[…]
Um die Weihnachtszeit 1932 begegnet Lale Andersen, deren neue Adresse gerade München, Hofgartenspiele Annast lautet, dem bekannten und tüchtigen Rechtsanwalt Dr. Alfred „Fredy“ Strauß. Sie ist begeistert von ihm: „Sie sind in meinen Augen eine Mischung aus bayerischer Offenheit, männlicher Kraft, menschlicher Reinheit und jüdischem Intellekt, Fredy. Gerne möchte ich Ihr Angebot annehmen, mit Ihnen über Weihnachten in die Berge zu fahren.“ Weihnachten regnet es leider, und anstatt sich bei winterlicher Sonne etwas zu erholen, sitzen die Gäste in der Hotelhalle herum. Dem verständnisvollen Freund Dr. Strauß vertraut sie an, daß das Singen von Chansons ihr immer wichtiger wird, der Wunsch, Theater zu spielen, dagegen unwichtiger. (Litta Magnus-Andersen, S. 32)
[…]
Lale Andersen lebt (recht unbeeindruckt von den politischen Geschehnissen) ihren Stil auf der Bühne und im Alltag unvermindert aus: Sie trägt Bubikopf, schlüpft für ihre Seemannslieder in Matrosenkluft und singt Tucholsky, Kästner, Brecht/Weill, kurz, alles was ihr gefällt. Im Sommer 1933 schreibt sie dann in ihr Tagebuch: „Nach meinem Auftritt im Hamburger Kaffeehaus Vaterland wird zum erstenmal, solange ich singe, an meinen Chansons korrigiert! Das eine sei zu übermütig, das andere sei verdächtig sozial, das dritte von einem jüdischen Autor. Wird alles verboten. Alles Protestieren, alle Empörung nützen nichts. Selbst die Rockhosen, die ich drei Jahre auf der Bühne tragen durfte, sind ab sofort verboten. Jetzt muß ich im Abendkleid auf der Bühne stehen und fades Zeug singen. Ich werde den Vertrag lösen. Wie das allerdings menschlich und finanziell zu bewältigen ist, davor bangt mir sehr“. (Litta Magnus-Andersen, S. 38)
Der Portier des Münchener Regina-Palast-Hotels empfängt ein paar Wochen später die junge blonde Künstlerin und teilt ihr aufgeregt mit, daß der bekannte Strafverteidiger, Rechtsanwalt Dr. Strauß, am 1. Juli im KZ Dachau erschossen wurde. Diese Mitteilung trifft sie völlig unerwartet; auch als ihre Freunde im Annast, einschließlich Frau Annast, es ihr ebenfalls bestätigen, kann sie es kaum glauben. Mit Fredy Strauß hatte sie ein herzliches und freundschaftliches Verhältnis. „Es ist einfach unfaßbar. So sinnlos.“ Sie erinnert sich, daß einige Kollegen vom Simpl des öfteren behauptet hatten, der Anwalt sei ein Angeber, ein Schürzenjäger. Nun soll er tot sein, umgebracht…, sie versteht es immer noch nicht, wird es auch nie begreifen. Ihre Meinung, wie gewohnt frei und unbeeinflußt zu äußern, auch ihre politische, schien Lale-Liselotte auf einmal riskant zu werden. Ihre Freunde hatten sie beim letzten Besuch in Zürich bereits gewarnt. (Litta Magnus-Andersen, S. 38)
[…]
Im Berliner »Wintergarten« steht sie im Matrosenanzug im Mai 1935 auf der Bühne und erheitert das Publikum als »Nordseekrabbe«. Das Wiesbadener Film- und Varieté-Theater kündigt Lale Andersen-Wilke als »die Nordsee persönlich« an. Danach vollzieht sich eine sichtbare Wandlung der Lale Andersen. Sie passt sich zunehmend den nationalsozialistischen Idealen und Inhalten an – von den Liedtexten und Komponisten über den Frauentyp bis hin zur Garderobe. Der kecke, freche Matrosenanzug, mit dem die emanzipierte Sängerin aufs Klavier gesprungen war, geziemt sich nicht für eine Frau, die im Nationalsozialismus als Sängerin überleben will. Aus der aparten jungen Künstlerin, wie sie 1935 unter dem Titel »Frauen in München« abgebildet ist, wird 1938 eine brave, weiblich-mütterliche, nordische Sängerin. Im weiten, weißen Norwegerkleid mit neuer Frisur entspricht sie dem nationalsozialistischen Frauenbild. (aus Gisela Lehrke: Wie einst Lili Marleen. Das Leben der Lale Andersen. Henschel-Verlag, Berlin 2002. S. 56 ff.)
[…]
Im Juli 1937 befindet sich die Künstlerin in München, wo im Festrausch das Haus der Deutschen Kunst eingeweiht und ebenso die berüchtigte Ausstellung Entartete Kunst gezeigt wird. Im Tagebuch notiert sie: „Die Bilder, die man fürs Haus der Deutschen Kunst angekauft hat, sind zum Teil so durchschnittlich und unter dem Durchschnitt, daß man in Scharen anschließend in die Ausstellung Entartete Kunst strömt, berauscht und andächtig vor Corinths Walchensee-Landschaften steht oder auch vor einer dunkelgrünen Abendlandschaft von Marcks. Plötzlich schämt man sich, daß diese Leinwandflächen, vom berauschten, andächtigen Auge Corinths gesehen und von seiner genialen Hand gemalt, den Begriff entartet tragen — und die blutarmen, zurechtgepinselten Akte Adolf Zieglers den neuen Begriff Deutsche Kunst verkörpern sollen.“ (Litta Magnus-Andersen, S. 65)
[…]
1937, aus einem Brief des Komponisten Rolf Liebermann:
»Liebe einzig Geliebte,
Du hast auf Deiner Karte den richtigen Ausdruck für die Situation gefunden. Das muss anders werden. Im folgenden ein ernster Vorschlag, den Du mir bitte sofort beantworten wirst: Die Bärentatze hatte in Basel einen riesigen Erfolg der leider mehr Presse- und moralisch war als finanziell. Solche jungen Läden müssen sich eben durchsetzen bevor sie rentieren. Wir sind ein Kollektiv haben aber vorgesehen als Kollektiv Gäste zu fixen Gagen zu engagieren. Wenn Du zusagst krieg ich das schon durch. Du müsstest aber Schweizerin werden, sonst kriegst Du (abgesehen von allem) sowieso keine Bewilligung.
Das Problem ist aber eben heute diskutierbar, weil Du sicher für diese Saison und nächstes Jahr untergekommen bist und Deine Existenz hast. Natürlich entspricht sie nicht Deinem deutschen Standard, dafür verdienen wir aber beide. Überleg Dir gut, es ist ein entscheidender Einschnitt, es ist die Aufgabe der deutschen Karriere, ein beinahe Neuanfangen, allerdings mit vielen Möglichkeiten.
Ich hab mir’s lang überlegt bevor ich Dir schrieb, denn ich diskutiere dieses Problem schon zwei Monate. Aber ich glaube, dass für Dich hier immer etwas zu machen sein wird, auch wenn die Bärentatze schief geht. Ich bin heute so drin, dass ich für Dich optimistisch bin, immer unter der Voraussetzung der Änderung der Nationalität. Allein die schweizerische Filmproduktion könnte Dich abgesehen von allem, ernähren […] Das Zusammenarbeiten wäre schon sehr schön und höchste Zeit […] Kuss Rolf«
[…]
»Zu Beginn des Dritten Reiches ging Lale Andersen wie viele andere nach Zürich, um dort als Ensemblemitglied des Züricher Schauspielhauses in kleinen und größeren Rollen tätig zu sein. Um sich in den Sommermonaten finanziell über Wasser halten zu können, trat sie schlacksig-blond mit Liedern ihrer norddeutschen Heimat in Cafés und Restaurants auf. Dennoch wurde Lale Andersen 1938 von der Schweiz in die Heimat abgeschoben, weil sie die bei der Einrichtung ihrer Wohnung gemachten Schulden nicht zurückzahlen konnte.
Lale Andersens neue künstlerische Heimat wurde München, wo sie im Simpl ein gern gesehener Gast war. Dort lernte sie auch Rudolf Zink kennen, den ersten Komponisten des Liedes von der Lili Marleen. Fortan gehörte jenes chansonhafte Lied zu ihrem Repertoire. Der Name Lale Andersen wurde in Kleinkunstbühnenkreisen zum Begriff, und irgendwann folgte der Ruf ans Berliner Kabarett der Komiker. Dort traf die Künstlerin mit Norbert Schultze zusammen, der ihr seine Version von Lili Marleen vorspielte. Jene Vertonung war es denn auch, die Lale Andersen – zunächst ohne nennenswerten Erfolg – 1939 auf Schallplatte aufnahm.« (Quelle: Ahlborn-Wilke (1986) S. 8 f.)
[…]
Im Herbst 1939 schreibt sie ins Tagebuch: „Es ist Krieg. Ich kann mich weder an das furchtbare Wort, noch an die entsetzliche, zur Wahrheit gewordene Tatsache gewöhnen. Wohl dem, dessen Leben immer Selbstdisziplin und Tapferkeit erfordert hat: Wir haben es jetzt leichter als die anderen, die plötzlich dieses andere Leben begreifen sollen. Was aus den Kindern, Pasche und mir wird, entscheidet die nächste Woche. Wahrscheinlich muß ich Paschi fürs Militär hergeben und den Beruf der Sängerin mit dem einer Schalterbeamtin oder ähnlichem vertauschen. Hoffentlich kann ich die Jungens [Björn und Michael] bei mir haben und für sie sorgen.“ (Litta Magnus-Andersen, S. 92)
[…]
Als eine der ersten Künstlerinnen ist Lale Andersen vom SS-Gruppenführer Hans Hinkel der Reichskulturkammer zu Auslands- und Fronttourneen „abkommandiert“. Etliche Wochen verbringt sie im besetzten Dänemark und singt hauptsächlich vor den Besatzungstruppen; doch als ihr Ruf als Chansonsängerin bekannter wird, engagiert sie Lulu Ziegler für ihr Kopenhagener Kabarett, wo sie im Februar 1941 auch Asta Nielsen hört und ihr nach der Vorstellung hinter der Bühne beteuert, wie sehr sie sich an Lales Liedern erfreut habe. In Dänemark wird ihr Wunsch nach einem internationaleren Repertoire größer. — Auf Lale wartet im März 1941 ein Engagement in Willi Schaeffers‘ Berliner Kabarett der Komiker. Sie mag noch gar nicht an den Abschied denken, an die ungewisse Zukunft, die in der Reichshauptstadt auf sie wartet. Die Kinder, Paschi, Haushalt… alles gehört zu einer anderen, harten, realistischen Welt. Ob man sich wieder einleben kann? Hier, in Dänemark, werden ihr keine Vorschriften gemacht. In Deutschland herrscht ein ganz anderer Ton, hat man sich unterzuordnen, der politischen Situation anzupassen. „Ob ich dazu fähig bin? Ich muß doch sagen können, was ich will. Ich will durch Selbstdisziplin mein Ziel erreichen und nicht durch mir aufgezwungene Disziplin anderer. Meine künstlerische Zukunft bereitet mir Sorge. Wie hoffnungsvoll hat es vor zehn Jahren begonnen in Berlin!“ (Litta Magnus-Andersen, S. 104f.)
[…]
Im April 1941 stoßen deutsche Truppen immer weiter auf dem Balkan vor und rücken am 11. April in Belgrad, der Hauptstadt Jugoslawiens, ein. Durch die kriegerischen Ereignisse ist die Stadt stark zerstört. Es wird Monate dauern, ehe einigermaßen Ordnung herrscht. Zu den dringendsten Aufgaben der deutschen Besatzung gehört die Einrichtung und Betreuung eines Sammellagers, in dem etwa 9000 Gefangene, darunter Marokkaner, Spanier, Franzosen und jugoslawische Juden untergebracht werden.
Besonders schwer zu schaffen macht den deutschen Soldaten das Sicherstellen der enormen Beute an feindlichen Kraftfahrzeugen. Auch das Instandsetzen der eigenen Truppenfahrzeuge bereitet große Probleme. Es fehlt der Truppe an geschulten Mechanikern. Gelöst wird dieses Problem, als Ende Mai Soldaten und Offiziere des Heereskraftfahrparks 533 unter der Führung seines Kommandeurs Hauptmann Hofbauer in Belgrad eintreffen.
Die Arbeit läuft bald auf Hochtouren. Dem HKP 533 mit seinen nur etwa 100 Mann wird fast zuviel zugemutet. Das Auseinanderliegen der einzelnen Dienststellen erweist sich als eine zusätzliche Belastung. Erst nach einigen Wochenwird die gesamte Verwaltung in einem Gymnasium untergebracht.
Gleich in der ersten Belgrader Zeit wächst die Arbeit des HKP ganz gewaltig. Zahlreiche Divisionen sollen für den Einsatz im Osten aufgefrischt werden. Täglich werden fast 300 Aufträge ausgeschrieben, so daß der HKP in kurzer Zeit rund 1800 Kraftfahrzeuge in Reparatur hat. Nach Dienstschluß bietet sich den Soldaten vorerst keine Möglichkeit, irgendwo in Belgrad Zerstreuung oder Abwechslung zu finden. Zwar existieren selbst in der zerstörten Hauptstadt ein paar relativ saubere Gaststätten und können Ausflüge in die nähere Umgebung gemacht werden, aber damit ist das Freizeitangebot so quasi erschöpft. Das muß geändert werden, beschließt der Kommandeur des HKP 533. Mit bereitwilliger Unterstützung seiner Soldaten richtet man sehr bald ein Soldatenkino mit zwei Vorführräumen ein. Auch ein Soldatenheim mit Leseräumen, Spielsälen und großer Kantine wird in kürzester Zeit zur Realität. Die Einrichtung eines Aufenthaltsraumes steht jetzt noch auf der Wunschliste.
Der Raum soll natürlich mehrere Funktionen haben. Ein Tischtennis soll zur Verfügung stehen, ein paar Spieltische gehören her, und eine gemütliche Plauderecke darf ebenfalls nicht fehlen. „Jetzt brauchen wir nur noch unseren eigenen Radiosender“, schlagen die Landser vor. Den einzurichten und mit Informationen und Schallplattenmaterial zu versorgen wird die Aufgabe von Karl-Heinz Reintgen, der zum Chef des Soldatensenders ernannt wird. Die Bezeichnung „Belgrader Wachtposten“ erhält der SEnder im Frühjahr 1941 noch nicht. Einiges muß sich nämlich erst noch ereignen, bevor man in der Heimat und an der Front allabendlich um kurz vor 10 Uhr Belgrad einschaltet, um Lili Marleen zu hören. [Magnus-Andersen, S. 109 f.]
Bis 1941 waren [vom Lied Lili Marleen] lediglich 700 Platten verkauft worden. Heute würde man das einen Flop nennen. Ab April 1941, als der Soldatensender Belgrad auf Sendung geht, wird das Lied bekannter. Zum Grundbestand des Senders gehörten zunächst 60 Schallplatten. Mit dieser eingeschränkten Auswahl ließ sich schwerlich ein abwechslungsreiches Programm gestalten. So beschaffte der Sonderführer [Richard] Kistenmacher kurzerhand vom Reichssender Wien mehrere Kisten Schallplatten, die ausgemustert worden waren. Darunter befand sich auch das Lied eines jungen Wachtpostens.
Glaubt man dem Bericht des Leiters des Senders Belgrad, Leutnant Karl-Heinz Reintgen, muß sich im Frühjahr/Sommer 1941 folgendes zugetragen haben: In diesen Monaten wurde Lili Marleen bis zu dreimal täglich gespielt. Die Auswahl an Schallplatten war immer noch nicht sehr groß, und die Sendezeit war auf 12 Stunden angestiegen. Von einem auf den anderen Tag nahm Leutnant Reintgen die Platte aus dem Programm, weil er der Ansicht war, daß der „Zapfenstreich“ [besagten Liedes] nun oft genug gesendet worden sei. Die Reaktion: eine Flut von Beschwerdebriefen und Beschimpfungen der Programm- und Musikgestalter. Man sah sich gezwungen, die Platte wieder ins Programm aufzunehmen.
Davon abgesehen erfreute sich der Sender immer größerer Beliebtheit, was sich in der steigenden Anzahl von Zuschriften ausdrückte. Und so suchten die Programmgestalter nach Möglichkeiten, den Soldaten eine Stimme zu geben. So entstand die Sendung Wir grüßen unsere Hörer, die erstmals am 18. August 1941 um 21.50 Uhr ausgestrahlt wurde. Am Ende dieser Sendung erklang jedesmal das Lied von der Lili Marleen. Mit dieser „Grußbrücke“ wurde das Lied zu einem neuen Verbindungsglied zwischen „der Heimat und der Front“.
Zunächst erreichten 3000 bis 4000 Briefe für diese Grußsendung die Redaktion, dies steigerte sich bis auf 12460 Briefe an einem Tag. Von Afrika bis zum Nordkap grüßen die Soldaten die Liebste daheim und warten mit ihr gemeinsam auf Lili Marleen. Der Text des Liedes wird aufgeschrieben und weitergereicht, es entstehen neue Versionen sowie zahlreiche Zeichnungen von Liebespaaren unter der Laterne.
In den Erzählungen der Zeitgenossen wird Lili Marleen magische Kraft zugesprochen. Die Waffen verstummen, wenn Belgrad kurz vor zehn Uhr sendet. So berichten es Soldaten des deutschen Afrikakorps und der britischen 8. Armee übereinstimmend. […] „Eine makabre Verbrüderung“, nennt [Norbert] Schultze jr. das in seinem Dokumentarfilm Wenn sich die späten Nebel drehn: „Hier zerschießen, verbrennen und vernichten sie sich gegenseitig und singen gleichzeitig dasselbe Lied. [Lehrke, S. 71 ff.]
Tagebucheintrag Ende Oktober 1941: „Manchmal, wenn ich an Lucienne Boyers Parlez moi d’amour oder an Tino Rossis J’attendrai gedacht habe, glaubte ich, so etwas sei bei mir nie möglich, daß einmal ein Lied durch mich das Lied ganz Europas werden könne wie jetzt Lili Marleen, denn ich singe keine Schlager, sondern bemühe mich seit jeher, Wort und Musik von zeitnahen, jungen Künstlern zu interpretieren. Nicht die Werke von Schlagerautoren will ich singen, sondern die von wahren Dichtern und Komponisten. Und nun ist von diesen Liedern eines das Lied dieser Zeit geworden, und ich muß mich daran gewöhnen, ‚berühmt‘ zu sein. Es wird sicher nicht allzu lange dauern. Entgegen den Ansichten von Zimmermädchen und unbekannten Kollegen bedeutet es für mich nicht ausruhen und sich feiern lassen, sondern ganz besonders viel und stark zu arbeiten.
Aus allen Ecken Europas kommen Bitten um Gastspiele. Zu Hause, so erzählen Björn und Michael, steht das Telefon nicht mehr still. Vielleicht ergibt sich nun endlich die Chance, sich die Sehnsucht nach einer größeren Wohnung zu erfüllen. Also werde ich jetzt noch einmal mit allen Voltstärken arbeiten und sparen.“ [Litta Magnus-Andersen, S. 115]
[…]
Lale ist im Frühjahr 1942 gerade in Berlin, als ihr von der Reichskulturkammer aufgetragen wird, in dem UfA-Propagandafilm G.P.U. (mit Andrews Engelmann und Will Quadflieg) mitzuwirken. Sie soll als Sängerin in einem Göteborger Lokal auftreten und eines ihrer nordischen Lieder vortragen – welches, bleibt ihr überlassen. Dürr wie eine Segelstange, steht sie dann Ende März vor der Kamera und singt schnodderig das schwedische Matrosenlied Sorte Rudolf, das bereits vor dem Kriege Teil ihres Repertoires war. Ihr Auftritt ist kurz und kaum bemerkenswert: Sie singt das Lied zerleiert, geradezu unkünstlerisch. Schnell ist ihre Szene abgedreht. Wenig später wird vorgeschlagen, sie auch für weitere Rollen zu ordern. Lale aber, froh sich ungebunden weiter ihren Gastspielen widmen zu können, lehnt ab mit den Worten: »Ich muß ja im April schon wieder auf eine längere Tournee, leider.« (Magnus-Andersen S. 121)
[…]
1942 (26. Mai) Pressenotiz in einer deutschen Zeitung:
Die Verführerin Lili Marleen
Meldung unserer Berliner Schriftleitung: Die Briten haben schon ihre Sorgen. Zu den vielen »glorreichen« Rückzügen, den Schiffsversenkungen und der Gewissheit, dass die Initiative an allen Fronten beim Gegner liegt, macht ihnen jetzt auch noch das Lied des Belgrader Soldatensenders, die »Lili Marleen«, arge Kopfschmerzen. Jedenfalls sieht sich der »Daily Herald« veranlasst, seinem Vertreter im Mittleren Osten Raum für einen Stoßseufzer zu geben. Besagter schrieb, dass etwas gegen Lili Marleen getan werden müsse, gegen jenes Lied, das jede Nacht die sentimentalen Ohren der Soldaten der 8. britischen Armee kitzle. Lale Andersen sei mit ihrer »Komm-und-küss-mich-Stimme« auf dem besten Wege, die Verführerin der Briten im Mittleren Osten zu werden. Ihr Lied findet den Weg zum Herzen des männlichen Heimwehs und rühre fast zu Tränen. Das Lied Lale Andersens habe eine derartige Berühmtheit bei den englischen Soldaten erlangt, dass sie der Rede Churchills in der Wüste nur mit einiger Ungeduld zuhörten, aus Angst, dass dies zu lange dauern könnte und die Briten dadurch um ihr abendliches Entzücken gebracht würden.
[…]
Im September 1942 ist Lale gerade auf Ferientournee in Italien (»Ich staune, dass das italienische Publikum bei mir so brav und still ist. Dabei haben wir diesmal kein Begleitorchester mit, sondern ich stehe, mit Paschi am Flügel, den ganzen Abend allein auf dem Podium«), als sie ein Brief von der Zentralstelle für Informations-Bibliotheken und Schallplatten-Archive erreicht. Sie schreibt darüber ins Tagebuch: »Nun soll also Lili Marleen auch in französischer, holländischer und italienischer Sprache von mir gesungen werden. Da werde ich mich wohl so langsam auf die Heimreise begeben müssen. Beim Gedanken an das Wiedersehen mit den Kindern hüpft mein Herz, anstatt vernünftig zu schlagen. Hoffentlich nimmt mir der Zoll nicht die Geschenke ab.«
Als Lale die Rückreise antritt, wird sie noch aus dem Zug heraus am Brenner von zwei Gestapobeamten festgenommen. Sie erfährt weder die Gründe der Verhaftung noch irgendwelche anderen Andeutungen. Sie habe unverzüglich nach Berlin zurückzureisen, sich nicht aus ihrer Wohnung zu entfernen und jederzeit zur Verfügung zu stehen. Ihr Gepäck wird in Beschlag genommen, ebenso ihre Tagebuchaufzeichnungen …
Warum wurde sie nach Berlin beordert? Warum kann sie die Wohnung nicht verlassen? Dass sie es nicht tun würde, wissen ihre Feinde. Schließlich hat sie zwei Söhne, beide leben bei ihr. War es ihre Weigerung, im Frühjahr das Ghetto zu besichtigen? Wenige Tage nach ihrer Rückkehr muss sich Lale in der Reichskulturkammer, Wilhelmsplatz 8/9, bei ihrem Widersacher, Hans Hinkel, melden. Innerlich zitternd, äußerlich so beherrscht wie nur möglich, steht Lale vor ihrem ärgsten Feind …
»Ab sofort Auftrittsverbot! Sie unterlassen sämtliche Interviews! Erwähnen Sie mit keinem Wort Ihren Namen und den von Lili Marleen. Sie werden keine Autogramme geben und nirgends Lili Marleen als Unterschrift setzen. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden!«
Dann deutet Hinkel auf die Briefe[, die sie an Kurt Hirschfeld nach Zürich schickte]. Er würde es ihr ersparen, den Inhalt vorzulesen oder gewisse »eindeutige« Passagen daraus zu zitieren.
»Außer, Sie bestehen darauf, Frau Andersen. Ich sollte Sie vielleicht daran erinnern, dass am Züricher Schauspielhaus vornehmlich Juden engagiert sind. Die Tatsache, dass Sie mit diesen ›Künstlern‹ aufgetreten und befreundet sind, ist bekannt. Als deutsche Künstlerin ist ihr Verhalten skandalös …« Nun sei sie … ein Opfer ihrer Einfältigkeit geworden. »Die Reichskulturkammer wird dafür sorgen, dass sie für ihr undeutsches Betragen bestraft werden. Sie werden von uns hören. Heil Hitler!«
Zwei oder drei Tage nach der Begegnung mit Hinkel teilt Björn seiner Mutter so gelassen wie möglich mit, vor dem Hauseingang stünden zwei Männer in Zivil, wahrscheinlich Gestapo … Sonst rasch zur Reizbarkeit neigend, benimmt sich seine Mutter auffallend ruhig. Sie sei abgespannt und möchte sich hinlegen, entschuldigt sich Lale bei ihrem Ältesten und der Haushälterin Koschel.
Nachts schluckt Lale eine Überdosis Veronal. Als Gestapobeamte sie abholen wollen, können sie die Sängerin nicht in Haft nehmen. Sie liegt in tiefem Koma.
»Holen Sie unverzüglich einen Arzt und einen Krankenwagen, Frau Andersen hat einen Selbstmordversuch gemacht!« ruft einer der Gestapomänner aufgeregt ins Telefon.
Minuten später fährt ein Krankenwagen vor das Haus Kurfürstendamm 92. Den anderen Bewohnern entgeht der Vorfall nicht. Geflüster, Getuschel … das sei doch Frau Andersen aus der obersten Etage gewesen, die abtransportiert wurde. Keiner wagt es in dieser Zeit, Fragen zu stellen.
Lale liegt noch im Koma, da wird von der BBC in London die Meldung verbreitet, Lale Andersen habe Selbstmord begangen. Hinzugefügt wird, Goebbels habe befohlen, die Sängerin von Lili Marleen wegen ihrer antideutschen Haltung zu verhaften und in ein Konzentrationslager zu transportieren. Der Verhaftung sei sie durch Selbstmord entgangen.
Tatsache ist, dass Lales Leben durch die »Falschmeldung« gerettet wird. Goebbels lässt ein Dementi verbreiten, um somit die BBC »wieder einmal einer Propagandalüge zu bezichtigen«. Lale kann in ihre Wohnung zurückkehren. Das von Hinkel verhängte Auftrittsverbot bleibt in Kraft. [Litta Magnus-Andersen S. 144 ff.]
[…]
1942–45: Englische Propagandalieder
Lale durfte – mußte – für die deutsche Propaganda einige Lieder singen, wozu der damals superbegabte Horst Kudritzki die Arrangements schrieb. Gleichzeitig wurden die Aufnahmen als Schallplatten von der ELECTROLA gepreßt. Sie gelangten aber nicht in den offiziellen Handel und trugen auch kein [offizielles] Label; lediglich zwei Instrumente über Kreuz, eines war soweit ich mich erinnern kann, eine Gitarre. Das Label hatte eine dunkelrote Farbe und war übrigens nur wenige Zentimeter groß. Bei Blue Moon stand nur der Titel und drunter ›Lale Andersen‹. Auf der Rückseite war Lilly Marlene. Diese Platte wurde aber damals – 1942 – unter dem Ladentisch in der Tauentzienstraße verkauft. Sie kostete – auch die anderen – RM 50. (Michael Wilke)
Andere Songs, die in englischer Sprache aufgenommen wurden, waren u. a.
Roll on the Blue Funnel (Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei)
Sing, Nightingale, Sing (Sing, Nachtigall, sing)
Home May Be a Word (Drunt in der Lobau)
When the Scented Lilac Blooms Again (Wenn der weiße Flieder wieder blüht)
Under an Umbrella in the Evening (Unter einem Regenschirm am Abend) oder
And so Another Lovely Day is Over (Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende).
Begleitet wurde sie mal vom UFA-Tanzorchester Wilhelm »William« Greihs, mal vom Orchester Lutz Templin nebst Karl »Charlie« Schwedler. Die Texte dieser Lieder sind recht harmlos, ja vielfach nur texttreue Übertragungen der ursprünglich deutschen Vorlagen ins Englische. Allein bei Roll on the Blue Funnel und bei Home May Be a Word wurde ein ganz neuer Text verfaßt, der Heimweh unter den englischsprachigen Hörer wecken soll. Ob sie der für seine nazifreundliche Haltung berüchtigte Engländer Norman Baillie-Stewart geschrieben hatte, läßt sich heute nicht mehr ermitteln.
Für die deutsche Wehrmacht zu singen, die so auf ihre Lili Marleen wartet, hat mir Hinkel verboten. Merkwürdig, und nun muß ich alle Innigkeit in englische Lieder legen, damit sie nach Übersee und zur Mittelmeer-Armee gesandt werden und die Herzen zu Deutschlands Gunsten betören. Lili Marleen ist nach langen Kämpfen von der englischen und amerikanischen Regierung freigegeben und DAS Lied geworden. (Tagebucheintrag Lale Andersens, September 1943)
Die Aufgabe, im nationalsozialistischen Interesse englische Lieder zu singen, hat sie wohl vom Juli 1942 bis Anfang 1945. Ins Tagebuch schreibt sie:
Im Übersee-Sender braucht man mich für englische Lieder nur einmal wöchentlich. Im deutschen Sender werde ich nicht beschäftigt. Mit Sendungen unserer unantastbaren wahrhaft Großen Beethoven, Bach, Goethe, Schiller, Schumann und Brahms glauben die Herren Sendeleiter, ihr hohes Niveau zu dokumentieren. Daß auch in unserer Zeit Komponisten leben und daß auch aus unserer Zeit Dichter sprechen, wissen sie nicht. Nur kein geistiges Experiment. Auf Anordnung des Auswärtigen Amtes nehme ich also in englischer Sprache Schallplatten auf oder singe in den eigenen vier Wänden, wonach mir das Herz steht. (Tagebucheintrag Lale Andersens, Anfang 1945)
[…]
Ihre Musik 1945–56: So viel Wind und keine Segel . . .
Die Musik ihrer Konzerte im September und Oktober 1945 ist eine Mischung aus alten, immer noch hörbaren Vortragsliedern der Hitlerzeit (wie Lyckan, Das muß man alles verstehen, der deutschen Fassung internationaler Schlager wie Red Sails in the Sunset), amerikanischer Klassiker (von George Gershwin oder Cole Porter) und Brecht-Weill-Songs. Wann immer sie also eine freiere Hand hat, greift sie zu Songs im besten Sinne. Auch die Plattenaufnahmen dieser Jahre haben anfangs noch ein unschnulziges Gepräge. Im Deutschland der Ruinen lagen auch die Produktionsstätten der Musikindustrie in Schutt und Asche. Um überhaupt wieder eine Platte einspielen zu können, reist Lale Andersen in die Schweiz. Für die Firma DECCA nimmt sie zwei Chansons auf: Sing, Nachtigall, sing und Das Meer [Lehrke 98].
Mit den Plattenverträgen kommt jedoch auch der Erfolgsdruck, und so singt sie ab 1950 vorrangig ›leichte Kost‹ wie Nach Regen scheint Sonne, In unserm Garten blühen Rosen, So viel Wind und keine Segel. Aber sie singt auch verdeutschte internationale Melodieschlager wie Please, Mr. Sun, Easter Parade, Ma Cabane au Canada, Blue Eyes Crying in the Rain, Play a Simple Melody, How High the Moon, Besame Mucho usw., bei denen es sich um Juwele ganz eigener Art handelt.
Gründe für die Schnulzen sind natürlich damaliger Zeitgeist, damit verbunden die Forderungen ihrer Produzenten – aber auch ihre Heirat mit dem Komponisten Artur Beul. Einige Lieder, die er für Lale schreibt, sind (damals schon) blanker Kitsch (»Wenn Kornblumen blühn / und Mohnblumen glühn / dann möcht ich mit dir / durch goldne Felder ziehn. / Die Lerche im Feld / singt: schön ist die Welt …« oder an »Seerosen blühn auf unserm Teich / die Welt ist wie ein Märchenreich / ganz leise rauscht der kleine Bach / und alte Träumen werden wach«). Dies darf jedoch nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, daß gleichzeitig gerade Artur Beul viele Lieder für Lale schreibt, die in Atmosphäre und Stimmung ganz eigen sind und unerreicht bleiben: Man denke nur an die erste Fassung von He, hast du Feuer, Seemann oder Regen im April oder Liselott vom Weserdeich oder Signorina oder Regenpfeifer, sing dein Lied oder Die Fischer von Langeoog und andere mehr.
Viele Tourneen muß Lale bestreiten; sie führen sie nach Mannheim, Ludwigshafen, Freiburg, Heilbronn, Schwäbisch Gmünd, Bad Neuenahr, Marburg, usf. Insgesamt 38 Vorstellungen müssen in nur knapp sechs Wochen gegeben werden – mit teilweise sehr gemischtem Erfolg: Lale bemerkt selbstkritisch, wie abgespannt sie aussehe, wie schrecklich mancherorts ihr Begleitorchester spiele und wie unvorhersehbar die Laune ihres Publikums ist.
Tagebuch, München, November 1954:
Ob meine Pechsträhne mit den Sternen zusammenhängt? Ich müßte in diesem Jahr eigentlich mit einem Schild um den Hals herumlaufen, auf dem steht: Achtung, Explosionsgefahr! Da war nicht nur die Sache mit der Filmrolle, die mir verlorenging. Da war die Reizbarkeit, weiterhin Tourneen zu machen, deren Stumpfsinn in Idee und Aufbau mich unerträglich anödete.
Ich löse in einem Anfall von Zorn über ein taktloses Wort des stellvertretenden Produktionsleiters meinen [POLYDOR-]Schallplattenvertrag (die Kollegen sagen statt Zorn ‚geistige Umnachtung‘). Obendrein weigere ich mich, zwei englische Titel zu singen, die für die USA vorbereitet waren, und bringe, da alles miteinander zusammenhängt, meinen ganzen Amerika-Vertrag ins Wanken. Es kommt noch schlimmer. Gestern werfe ich die Leiterinnen des Lili-Marleen-Clubs zum Tempel hinaus, weil mir ihre Augenverdreherei und das Schwärmen so auf die Nerven ging, daß ich nicht anders konnte. Ich mußte ihnen zeigen, daß ich kein Halbgott, sondern z.Zt. ein unbeherschter menschlicher Vulkan bin. Brrrrrr. Ich bin mir langsam selbst nicht mehr geheuer. [Magnus-Andersen 198 f.]
Tagebuch, New York, Januar 1955:
Von Bob Krolls berühmten Coucher’s Studio blicke ich aus einem Eckfenster auf den Broadway und seine Millionen Lichter, die aussehen wie Augen, die einem Mut zuzwinkern. Vor zehn, elf Jahren, als die Lili-Marleen-Psychose die Welt erfaßt hatte, haben diese Lichter auch nach mir gerufen. Aber erst war Krieg, dann kam die Nachkriegszeit, und ich konnte nicht kommen. Nun ist es ein bißchen spät. Jetzt nützt alles Zuzwinkern nichts mehr.
Natürlich wäre ich gerne in New York geblieben, wenn ich jünger wäre. Jetzt bin ich zu gescheit geworden und weiß, daß all die Entbehrungen, Konzessionen, Erniedrigungen und Enttäuschungen einen zu hohen Preis darstellen für ein paar Jahre im Scheinwerferlicht. Der Scheinwerfer dreht sich immer weiter wie ein Lichtkegel. Und wendet er sich einem neuen Gesicht, einer neuen Stimme zu, beginnt der bittere Kampf von neuem, denn die Rückkehr ins Dunkle, Namenlose, die Gefahr, nicht mehr zu interessieren, ist für jeden Künstler bitter. Alles freiwillige Tun im Leben ist schön. Schön wäre es auch, freiwillig zu sagen: Genug der Singerei, des Ehrgeizes, des Applauses und der Ruhelosigkeit. Genug der Interviews, der Autogramme, des ewigen ‚Keep Smiling‘.
In ein paar Tagen muß ich abfliegen und in mein unfreiwilliges Leben zurückkehren. An meine nächste Tournee mag ich noch nicht denken. Das alles kommt früh genug, wenn es wieder heißt: Münster, Rheine, Düren, Recklinghausen, Nordhausen und… und… und… Wie schön, daß ich vorher noch ein paar Tage mit Turi [Artur Beul] in Zürich zusammensein kann. Auf ihn und auf das Wiedersehen mit Langeoog im Sommer freue ich mich. [Magnus-Andersen 201]
Tournee durch Bayern, Auftritte in der Schweiz, Jahresende 1955:
In Bern muß sie zwischen Weihnachten und Neujahr auftreten… Aufgekratzt und mit einem kleinen Schwips – Silvester steht ins Haus – möchte Lale zu gern einmal ohne Lili Marleen von der Bühne abtreten. Sie probiert es, doch ohne Erfolg. Erst rufen nur wenige Stimmen nach dem Lied, dann immer mehr, letztlich verlangt es der ganze Saal. Mit Seemannsgarn tritt sie vor das Publikum. „Mir scheint, ich habe etwas vergessen. Was war es nur gleich?“ – Die Antwort war zu erwarten: „Lili Marleen, Lili Marleen…“ – „Tscha, dann muß ich Ihnen wohl das Lied, das uns einmal soviel bedeutet hat, von dem ich aber hoffe, es wird nie mehr aktuell, singen.“ Die letzte Strophe summen viele mit, und als der Vorhang endlich fällt, fällt auch der Vorhang des alten Jahres. In melancholischer Stimmung kehrt Lale allein ins Hotel zurück. Wieder ist ein Jahr vergangen. Was wird 1956 ihr bringen? [Magnus-Andersen 202 f.]
[…]
1956, Versuch eines Repertoirewechsels
Tagebucheintrag im Winter 1956: Ich merke halt langsam, daß ich ein altes Mädchen bin, von dem man in Fachkreisen sicher sagt: ‚Eine nette Person, die Andersen, aber mit der Singerei sollte sie langsam Schluß machen.‘ Leider zwingt mich meine finanzielle Situation, solche Bemerkungen, so charmant es mir irgend möglich ist, zu überhören. […] Am schlimmsten ist aber die Feststellung einer Passivität, ein Nachlassen der Kampffreudigkeit. Unser Beruf, der keine Sicherheiten hat, ist ja ein täglicher, ein stündlicher Kampf. Unter meinen letzten Platten war kein Bestseller, und ich kämpfe seit Monaten vergeblich um neue Aufnahmen. Brrr – langsam mag ich nicht mehr.
‚Von der Andersen hört man gar nichts mehr‘, sagt auch mein Hörer-Publikum.
Wie viele Programmvorschläge habe ich ausgearbeitet und verschickt. Keine Antwort. Und so rutscht man, noch als Star, langsam zurück ins Kabarett. Das einzige, was mir bleibt und welches mir, schon einmal, vor 25 Jahren, die einzige Verdienstchance bot.
Schöner wäre das Milieu von Theater, Film oder Funk. Aber dort entscheiden neben der Begabung die Vor- und die Schlafzimmer. Ich habe mein Leben lang eines so wenig gemocht wie das andere. Mit einem tiefen Seufzer beende ich diesen grauen Monolog. [Magnus-Andersen, S. 203]
Tagebucheintrag, Januar 1957: Jetzt ist die Post meiner doch fündig geworden. Es befinden sich auch ein paar Engagementsmöglichkeiten darunter. Die werde ich wohl, wenn auch seufzend, akzeptieren. […] Am selben Abend – hurra – ein Anruf aus Köln: die Electrola will eine Langspielplatte mit mir machen. […] Abends kommt ein Anruf aus München bezüglich meiner Brecht-Weill-Dreigroschen-Oper-LP. Wie schön, daß auf dem Plattenmarkt wenigstens noch einer an mich glaubt. [Litta Magnus-Andersen, S. 206]
[…]
1969: Auftritt in Peter Zadeks TV-Zweiteiler Der Pott
Seit dem Ende der 1960er Jahre machten etliche bundesdeutsche Regisseure von sich reden, die eine schroffe Abkehr von herkömmlicher Theater- und Filmästhetik betrieben – man denke nur an Rainer-Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff, Rosa von Praunheim oder Peter Zadek. Im Oberhausener Manifest vom 28. Februar 1962 hatten sich bereits junge Filmschaffende für einen „neuen deutschen Film“ ausgesprochen und sich für eine Abkehr vom kommerziellen Film stark gemacht: „Opas Kino ist tot!“ hieß es.
Gerade Künstler, welche durch die Kommerzialisierung des Kulturbetriebs berühmt geworden waren, versuchten nun durch Zusammenarbeit mit jungen deutschen Regisseuren der Enge zu entfliehen, in die sie durch das Festgelegtsein auf „ihre Schiene“ und ihre einstige übergroße Bekanntheit geraten waren. Für Karlheinz Böhm, Brigitte Mira und Evelyn Künneke erfüllte sich dieser Wunsch.
Auch Lale Andersen seufzte in ihren Tagebüchern bisweilen über ihr Schlagerjoch und wünschte sich, einmal unter einem Regisseur wie Zadek zu spielen. Tatsächlich besann sich ebendieser kurze Zeit später auf sie und ermöglichte ihr einen Kurzauftritt in seiner Verfilmung von Sean O’Caseys Theaterstück „Der Pott“ („Der Preispokal“ = The Silver Tassie, 1928). Darin spielt sie die Rolle einer truppenbezaubernden Sängerin, zu der die Soldaten aufschauen und denen sie zum Durchhalten ein weiches Liedchen mit dem harten Text „Tragt sie sanft“ singt. Nachdem sie gesungen hat, ist in den abgeschlafften Feldtrupp wieder Leben zurückgekehrt: mit ermunternden Armbewegungen stachelt sie sie auf. Dann geht der Krieg weiter.
In seinen zur Jahrtausendwende im Rowohlt-Verlag erschienenen Lebenserinnerungen hat Regisseur Peter Zadek geäußert, daß es ein sehr angenehmes Arbeiten mit Lale Andersen gewesen sei, doch habe sie wahrscheinlich nicht einmal gemerkt, wie sehr sie sich mit ihrer Filmszene selber exponierte.
Zadek tut ihr damit durchaus Unrecht. Man merkt an Lale Andersens Auftritt und ihrer feinen Spielweise, daß ihr inzwischen sehr wohl bewußt wurde, welche Schraube sie selbst (anfangs vielleicht unfreiwillig) im Kriegsgetriebe war. Der Film zeigt es auch unmißverständlich: In einem Abendkleid als Umsäuslerin der Truppen, behechelt von Soldaten wie Hunde, lächelnd und singend von Grausamkeiten, die ja gar nicht so schlimm wären und ja doch ihren Sinn hätten, und daß einem „Kämpfer für die Ehre“ immer jedes Mädchenherz gehöre… Sie hat sehr wohl verstanden, was sie da singt, und es darum auch einmalig interpretiert: nämlich genau wie eine Sirene, die den Soldaten ein lächelndes Verführergesicht zeigt, zwinkernd, schmelzend, um auf ihre Art zum Weiterkämpfen aufzustacheln und das Sterben als sinnvoll hinzustellen. Mit ihrem weißen Abendkleid und ihrem Kopfschmuck ist sie ein schroffer Gegensatz zu den schmutzigen, im Felde liegenden Kriegern.
Diese angebliche Selbstentblößung von Lale Andersen wirkt bei eingehender Betrachtung sogar wie ein Versuch der Wiedergutmachung. Es wäre nämlich die einzige Wiedergutmachung, die überhaupt sinnvoll ist: öffentlich (und sich selbst exponierend) die herangereifte Erkenntnis zeigen – und nun für diese Erkenntnis einstehen; notfalls auch mittels einer Karikatur seines eigenen Berufsstandes aus unrühmlichen Zeiten. Doch es kann nur als Karikatur ihres Berufsstandes aufgefaßt werden, statt einer Karikatur ihrer selbst: Lale Andersen hatte genug eigene lebensbedrohliche Schwierigkeiten mit den Nationalsozialisten.
Die harsche Abkehr der jungen deutschen Regisseure von dem Gewesenen hat Zadek, Fassbinder und andere vielleicht fühllos oder geringschätzend gemacht für feinere Arten der Abkehr vom Gewesenen. Für sie galt nur ein harter Bruch und eine absolute Umkehr; nicht herumfeilen, verbessern, abwägen.
An Rainer-Werner Fassbinder sieht man dies: Er wollte mit seinem „Lili Marleen“-Film gültige Aussagen zum allgemeinen Kulturbetrieb in der Nazizeit treffen, also schien ihm ein Verändern der Buchvorlage des Films zulässig. Damit schärfte er zwar – genau wie Zadek – den Blick fürs Abgrenzen des Schwarzen vom Weißen, übersah dabei aber alle Grau- und Zwischentöne, die der Wirklichkeit gerechter werden und näherkommen.
Das wahrhaft Spannende, nämlich das Verwobensein von Schwarz und Weiß, nahm sich als Leitgedanken erst Gisela Lehrke für ihre 2002 erschienene Buch-Biographie Lale Andersens vor: „Mir war daran gelegen, gerade dieses Bild ‚die Nazi-Sängerin‘ doch zu korrigieren. So einfach ist die Welt nicht. Sie ist auch vor allem nicht schwarz und weiß, wie man bei Lale Andersen sehen kann: Man kann einen Schlager machen, der im Krieg zum Hit wird, und mit einem Terror-Regime in Verbindung gebracht werden, von dem man selber verfolgt worden ist.“ (Gisela Lehrke am 08.08.2002 in der N3-Nachmittagssendung DAS anläßlich der Buchvorstellung)
[…]