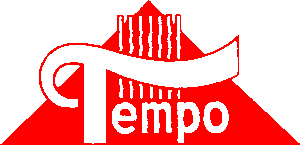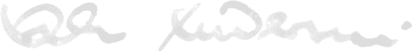Mitunter trickreich haben Musikproduzenten zur Nazizeit versucht, an der Reichskulturkammer vorbei heiße Tanzmusik auf Schallplatte unterzubringen, sozusagen zu verschleiern. Ein lahmes Musik-Intro, hinter dem zunächst niemand eine „heiße“ Nummer vermutete, bewusst keine oder falsche Rhythmusangaben bis hin zu harmlosen, ja langweiligen Liedtiteln wie „Melodie in Moll“, „Studie in F“ oder „Alo-Ahe“. Dann aber lassen sich hören: Elemente von Jazz, Swing, Big-Band-Sound, Blues – Anklänge an das, was Kulturwächter jener Zeit als „undeutsch“ und „artfremd“ herabstuften. Wo wurde so etwas gemacht? Zum Beispiel von 1938 bis 1945 bei der Schallplattenfirma Tempo in Potsdam-Babelsberg.
Die Marke Tempo...
…ging aus der Tonträgerfirma Brillant AG hervor, die 1931 vom Unternehmer Otto Stahmann in Berlin-Wilmersdorf gegründet worden war, um Schallplatten im Niedrigpreisbereich zu produzieren. Die Tempo-Schellack galt schon bald als die Schallplatte für das Volk. Sie kostete nur 1 Reichsmark (RM), während Telefunken ab 2 RM, Odeon und Electrola ab 2,50 RM für ihre Neuerscheinungen verlangten. Außerdem wurden die Tempo-Platten nicht über den herkömmlichen Musikhandel, stattdessen über die Kauf- und Warenhäuser angeboten, waren somit reichsweit in jeder größeren Stadt zu bekommen. Um die Marke möglichst preiswert zu halten, griff die Firma nicht auf weithin bekannte Künstler, sondern auf unbekanntere zurück und zahlte ihnen mit „5 Mark fürs Arrangieren, 5 Mark fürs Dirigieren, 5 Mark fürs Spielen“ auch keine hohen Gagen.
Dieses Vertriebsmodell wurde im Laufe der 1930er Jahre so erfolgreich, dass der Firmenchef seine Fabrikation schon bald vergrößern wollte.
1936 kaufte Otto Stahmann deshalb die Nowaweser Grundstücke Auguststraße (später Tuchmacherstraße) 45 und Wilhelmstraße (später Alt Nowawes) 67 und verlegte zwei Jahre später seine gesamte Schallplattenproduktion hierher. Auf den zwei aneinandergrenzenden Grundstücken nutzte er alle Gebäude des Vorbesitzers weiter. Das Gelände der seit 1927 hier ansässig gewesenen Schirmstockfabrik des emigrierten jüdischen Eigentümers Bernhard Noa stand verwaist und wurde mit dem Kauf Stahmanns „arisiert“. (Auch dieser hatte die Fabrikgebäude von seinem Vorgänger, der Nowag Märkische Celluloidfabrik GmbH übernommen.) Also bekam Stahmann keine Probleme mit der Kontingentierung von Baumaterialien: Er hatte schlicht kaum Neues zu bauen.
-
 Das Firmengelände der „Tempo“ in Potsdam-Babelsberg. Auf allen Schallplattenhüllen der Marke waren die Presswerke in schematischer Zeichnung abgebildet – von der Tuchmacherstraße bzw. Auguststraße 45 (rechts) zum hinteren Teil des Grundstücks Alt Nowawes bzw. Wilhelmstraße 67 (links). Nur wenig kriegsversehrt, konnte das Gelände von der 1946 gegründeten „Lied der Zeit GmbH“ und später verstaatlichten VEB „Deutsche Schallplatten“ bis 1991 weitergenutzt werden.
Das Firmengelände der „Tempo“ in Potsdam-Babelsberg. Auf allen Schallplattenhüllen der Marke waren die Presswerke in schematischer Zeichnung abgebildet – von der Tuchmacherstraße bzw. Auguststraße 45 (rechts) zum hinteren Teil des Grundstücks Alt Nowawes bzw. Wilhelmstraße 67 (links). Nur wenig kriegsversehrt, konnte das Gelände von der 1946 gegründeten „Lied der Zeit GmbH“ und später verstaatlichten VEB „Deutsche Schallplatten“ bis 1991 weitergenutzt werden.
Anderer Standort, andere Rhythmen
Man könnte vermuten, die in Babelsberg ansässigen Plattenfirmen (neben der Tempo war das bis 1932 noch die Electrola) hätten vor Ort gar keine Aufnahmestudios gehabt, sondern ihre Aufnahmen in Berlin durchführen lassen. Für die Electrola stimmt dies auch. Otto Stahmann dagegen strebte mit dem Umzug nach Potsdam zugleich einen Repertoirewechsel an. Er wollte sein Musikangebot aufbessern, verjüngen. Und so gab es ab Juli 1938 hier auf Stahmanns Firmengelände eigene Aufnahmeräume unter Leitung eines Tontechnikers namens Leibrock.
An das Gewinnen neuer Künstler für Tempo erinnert sich ein Zeitzeuge aus Stahnsdorf, der im Herbst 1938 als Praktikant in der Firmenverwaltung arbeitete:
„Stahmann wollte einen moderneren Anstrich für das musikalisch biedere Repertoire seiner Firma erreichen und ‚befahl‘ Leibrock, sich deswegen Gedanken zu machen – das Repertoire sollte einfach etwas weltmännischer werden, so wie bei den großen Berliner Firmen. Leibrock suchte nach Kooperationspartnern im Ausland zum Matrizenaustausch, was sich als schwierige Aufgabe herausstellte… Ich erinnere mich an viele Telefonate, an deren Ende er ziemlich entnervt war. Es gelang ihm schließlich nur, mit kleinen Firmen in Ungarn, Belgien und der Schweiz einen Austausch zu vereinbaren…
Das genügte Stahmann nicht. Ich erinnere mich gut an eine Sitzung im Foyer der Presswerke, bei der er, Leibrock und Kurt Widmann [Kapellmeister des Berliner Hotels ‚Imperator‘] zusammenkamen und ich den Kaffee bringen durfte. Widmann wurde hier zum Wechsel zu Tempo überredet, und um ihm das schmackhaft zu machen, kam Leibrock auf einen genialen Einfall, der auch das Problem mit den fehlenden angloamerikanischen Titeln im Katalog – die die Konkurrenz im Übermaß anzubieten hatte – lösen konnte: Er offerierte Widmann die Möglichkeit, heiße Tanzmusik wie den ‚Tiger Rag‘ aufzunehmen, allerdings, um sich gegenüber der Reichsmusikkammer zu schützen, als scheinbar ausländisches Orchester, so dass weder die Firma noch Widmann belangt werden konnten. Es wurden allerlei englische Phantasienamen erfunden und verwendet… Damit war Kurt Widmann einverstanden, ja er war sogar von der Idee regelrecht begeistert und besiegelte per Handschlag den Kontrakt. Anstatt Kaffee musste ich dann Cognac bringen!“
Produktion 1938 bis 1945
Bereits im Dezember 1937 war in Deutschland untersagt worden, sogenannte „entartete Musik“ auf Schallplatte zu verbreiten, was sich vor allem auf einzelne Titel oder die Musik jüdischer Künstler bezog. Seit 1938 aber kennzeichnete ein Erlass einen ganzen Musikstil, den Boogie-Woogie, als verboten. Erst recht nach Kriegsbeginn verfolgten Reichskulturkammer und Gestapo alle Zuwiderhandlungen gegen solche Bestimmungen. Deshalb musste Otto Stahmann, wenn er bei seinem Musikstilwechsel bleiben wollte, trickreich und erfinderisch sein, etwa wie eingangs erwähnt, durch irreführende Titel oder unverfängliche Anfangstakte.
Aber auch z.B. sinnliche Rumba-Rhythmen („artfremd“ in den Augen der Machthaber) veröffentlichte Stahmann; auf den Plattenetiketten allerdings einfach als Foxtrott deklariert, so schöpfte keine Behörde Verdacht.
In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass die Potsdamer Firma z.B. in Einzelfällen missliebige Künstler, wie 1942 die ‚halbjüdische‘ Refrainsängerin Margot Friedländer, verdeckt auf Schallplatte herausbrachte. Friedländer, die offiziell in Berlin nur noch als Friseurgehilfin oder später in einem Kino als Platzanweiserin arbeiten durfte, erschien bei Tempo – natürlich unter Pseudonym. (Ihre eigentliche Karriere begann erst nach Kriegsende mit dem Radio-Berlin-Tanzorchester und erstreckte sich in Ost wie West bis in die 1960er Jahre.)
Weitere namhafte Künstler, die für Otto Stahmann auf dem Potsdamer Firmengelände einspielten und -sangen, waren neben Kurt Widmann u.a. Franz „Teddy“ Kleindin, Bernhard Etté, Emanuel Rambour vom Hotel ‚Kaiserhof‘ in Berlin, Horst Winter aus der Carlton-Bar, oder Rudi Schuricke.
Nach einem Bombentreffer 1944 verlegte man die Aufnahmeapparaturen: Kurt Widmann erzählte später, er habe seine letzten Aufnahmen in einem Lagerraum voller Bettmatratzen machen müssen. Horst Winter (der „deutsche Frank Sinatra“, später in Wien berühmt) spielte seine letzten Lieder für Tempo am 4. Dezember 1944 in einer völlig ungeheizten Babelsberger Garage ein – Aufnahmen, die noch zum Weihnachtsgeschäft 1944 in den Handel kamen. Doch die Firma hielt ihre Produktion mit Auftragspressungen sogar bis zum April 1945 aufrecht!
-
 Eine Schnulze wie „Zum Abschied reich ich dir die Hände“ endet in einem Boogie-Woogie, der per Erlass seit 1938 verboten war. Oder: Sinnliche Rumba-Rhythmen, allzu „exotisch“ in den Augen der Machthaber, deklarierte Stahmann – wie hier auf dem Etikett der tanzbaren Serenade „Wolken segeln durch die Nacht“ – einfach als Foxtrott, und führte so die Kulturbehörden in die Irre.
Eine Schnulze wie „Zum Abschied reich ich dir die Hände“ endet in einem Boogie-Woogie, der per Erlass seit 1938 verboten war. Oder: Sinnliche Rumba-Rhythmen, allzu „exotisch“ in den Augen der Machthaber, deklarierte Stahmann – wie hier auf dem Etikett der tanzbaren Serenade „Wolken segeln durch die Nacht“ – einfach als Foxtrott, und führte so die Kulturbehörden in die Irre.
Weiternutzung nach 1945
Der Zusammenbruch des ‚Tausendjährigen Reiches‘ trieb die Tempo-Künstler in alle Winde, Otto Stahmann selbst ging nach München. Einige Pressmatrizen hatte er nicht mitgenommen, sondern in Babelsberg zurückgelassen. Mit diesen Matrizen (zumeist genau jenen „heißen“ Einspielungen der NS-Zeit) begann die Nachkriegsproduktion der einzigen Schallplattenfirma der Sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR Lied der Zeit GmbH. Sie wurde vom kommunistischen Schauspieler und Sänger Ernst Busch auf Geheiß der russischen Militärkommandantur 1946 gegründet und bis zu ihrer Verstaatlichung 1952 geleitet. Seitdem produzierte am Potsdamer Standort der VEB Deutsche Schallplatten Berlin zuletzt bis zu 69.000 schwarze Scheiben am Tag. – Doch dies ist wieder anderes Kapitel der Geschichte.
Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass durch die Weiternutzung des Tempo-Geländes von 1938 bis 1991 nahezu ununterbrochen Schallplatten in Potsdam hergestellt wurden. Ab der Vinylzeit stammte sogar jede ostdeutsche Scheibe, die sich auf DDR-Plattentellern drehte, aus Potsdam-Babelsberg.
Heute steht kein einziger der alten Werksbauten mehr. Das gesamte Gelände wurde nach 1991 planiert und im Jahre 2000 an gleicher Stelle der „Weber-Park“ errichtet. Nur noch dessen Eingangsgebäude an der Straße Alt Nowawes (Nr. 67) erinnert mit einem ähnlichen Neubau an seinen Vorgänger am alten Standort: Heute werden dort allerdings ganz andere „heiße Scheiben“ hergestellt, nämlich die von Pizza Max.
Quellen
Untere Denkmalschutzbehörde Potsdam, Acta Specialia: Alt Nowawes 67 – Klaus Krüger in ZS: Fox auf 78 (27/2013) –Email-Wechsel d. Verf. m. Stephan Wuthe, Berlin (2011 u. 2014) www.swingtime.de – Bernd Meyer-Rähnitz: Die ewige Freundin (2006) – Reinhard Otto: Die frühere Schallplattenproduktion in Babelsberg und Nowawes (Vortrag auf IASA-Tagung 2003) – Horst Winter: Dreh dich noch einmal um (1989) – Roman Lewandowski in ZS: Vier Viertel (22/1948).
Autor: M. Deinert – Dieser Text erschien mit leichten Änderungen abgedruckt im Kultur- und Gesellschaftsmagazin für das Land Brandenburg, potsdamlife, Heft 38 (=4/2014), S. 52–54.